 |

|
 |
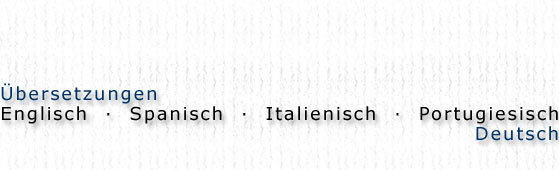

Justo Navarros Roman F. (Anagrama 2003) erzählt fragmentarisch das Leben des katalanischen Dichters, Übersetzers, Kosmopoliten und Selbstmörders Gabriel Ferrater: eine streckenweise seltsam heitere, da doch von Anfang an tragische Geschichte. Obwohl der atmosphärisch dichte Roman voller zeitgeschichtlicher Einzelheiten steckt, spielt darin die Sprache selbst eine Hauptrolle.
[...] allein die Wörter schienen ihm Schwierigkeiten zu bereiten.
Nicht, dass es Ferrater an Worten gefehlt hätte, in acht, neun oder
zehn Sprachen hatte er ihrer übergenug; im Gegenteil, er trug einen
ungeheuren Wortballast mit sich, der artikulatorische und mentale Staus
verursachte. In seinem Denken entstand ein Loch, ein Abgrund, viele Abgründe,
aber nein, das traf es nicht genau: Es war schlicht eine Unmenge von Worten,
es waren all die gelesenen, gehörten, wiederholten, gedachten, verzweigten,
vervielfachten Wörter. Wörter über Wörter strichen
alle Wörter aus: die Wörter über den Wörtern waren
am Ende nur noch eine Tintenkleckserei, ein schwarzes Loch, als würde
ein Schriftsteller schreiben und schreiben und ein Blatt füllen,
das einmal weiß gewesen ist, dann korrigieren und streichen und
korrigieren und noch mehr Wörter und noch mehr Streichungen und noch
mehr Wörter hinzufügen, bis das Blatt vollkommen schwarz ist,
was so viel heißt wie vollkommen weiß.
Ferrater schaffte Wörter beiseite, um sich für andere zu entscheiden,
mit schmerzlichen Gesten, als handle es sich bei der Arbeit an den Wörtern
um körperliche Schwerstarbeit, und wenn er die Bausteine verschob,
so war es, als wirbelten sie Staub auf und hüllten ihn in eine Wolke
der Verwirrung. Er kleidete sich sportlich, in Hemd und Arbeiterhose.
In seinem polyglotten Fieber hatte er nun auch die skandinavischen Sprachen
bezwungen. Es ging ihm nicht darum, jemanden mit Worten von irgend etwas
zu überzeugen: Bezaubern, das war genug.
(aus Kapitel 22)
